Dr. Martin Bertau, Professor für Technische Chemie an der TU Freiberg, warnt im Gespräch mit Gateway to Automotive vor einseitigen Denkweisen in der Energiewende und fordert einen realistischen Blick auf die Lithiumversorgung Europas. „Es fehlt in Deutschland an allem – außer an Bedenken und Bürokratie“, sagt der Chemiker und bringt damit auf den Punkt, warum Europa bei der Batterieproduktion ins Hintertreffen geraten ist.
Bertau betont, dass nicht Lithium selbst knapp sei, sondern die industrielle Basis für dessen Verarbeitung: „Wir sind nicht von China abhängig, wenn es um Lithium als Rohstoff geht, sondern bei der Herstellung von Lithiumbatterien. Das ist ein hausgemachtes Problem.“ Zwar verfüge Europa über reiche Vorkommen – etwa Spodumen in Portugal, Finnland oder Tschechien sowie Zinnwaldit in Sachsen und Böhmen –, doch mangele es an Unternehmen, die daraus Batteriematerialien gewinnen könnten. Die Verlagerung zentraler Industrien habe dazu geführt, dass „die Zukunftsindustrien, die wir für die Energiewende brauchen, außer Landes verlagert wurden“.
Lithium bleibt zentral – doch Alternativen gewinnen an Bedeutung
Die Bedeutung von Lithium sieht Bertau auch langfristig als stabil. „Lithium ist ein wachsender Markt, nicht nur für E-Auto-Batterien, sondern zunehmend auch für Haushaltsgeräte.“ Kritischer sei die Versorgung mit Kobalt, das vor allem in NMC-Batterien verwendet wird. Hier drohten Engpässe. Hoffnung macht der Professor auf neue Zellchemien: „Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind mittlerweile auf einem ähnlichen Leistungsniveau wie NMCs, und Natrium-Eisenphosphat-Batterien sind im Kommen.“ Damit verschiebe sich der Fokus weg von besonders knappen oder ethisch problematischen Rohstoffen.
Dass China eine Sonderrolle einnimmt, sei keine Überraschung. „China investiert massiv in eigene Technologien und hat kürzlich eine große Lithiumlagerstätte entdeckt“, so Bertau. Mit den damit verbundenen Förder- und Verarbeitungskapazitäten könne das Land die globalen Marktpreise beeinflussen. Während dort Lithiumcarbonat derzeit rund 11.400 US-Dollar pro Tonne koste, kalkulierten europäische Projekte mit über 20.000 US-Dollar. „Zinnwaldit bietet hier als heimischer Rohstoff erhebliche Chancen“, betont er, sieht jedoch fehlende industrielle Umsetzung als Haupthindernis.
Kritisch äußert sich Bertau zur Vorstellung, die ökologischen Folgen der Elektromobilität in andere Weltregionen zu verlagern: „Die Umweltlast einfach in ärmere Länder zu exportieren, halte ich für unethisch – nur weil wir keine eigenen Bergwerke haben wollen.“ Am Beispiel der globalen Lieferkette verdeutlicht er die Komplexität: „Das Soda, das man zur Lithiumgewinnung braucht, kommt aus Bernburg, reist nach Lateinamerika, weiter nach China und Südkorea – bevor die Batterien wieder zu uns kommen.“ Diese Transporte vergrößerten den sogenannten CO₂-Rucksack der E-Mobilität deutlich.
Direkte Lithiumextraktion als Zukunftstechnologie
Bertau sieht Potenzial in neuen Verfahren wie der direkten Lithiumextraktion (DLE), bei der Lithium über Elektroden gewonnen und die Sole anschließend wieder in den Boden geleitet wird. Voraussetzung sei allerdings höchste Sorgfalt: „Sobald Chemie eingesetzt wird und Stoffe ins Grundwasser gelangen, bin ich sehr zurückhaltend.“ Technologisch hält er das Verfahren für interessant, aber noch nicht ausreichend erprobt.
Neben Lithium und Natrium rückt für Bertau ein weiterer Rohstoff ins Zentrum: Phosphat. „Lithium- und Natrium-Eisenphosphat-Batterien benötigen Phosphorsäure – und Phosphat wird zur Schlüsselressource.“ Bereits heute flössen zehn Prozent des globalen Phosphors in Batterien, in direkter Konkurrenz zur Landwirtschaft. Deutschland nehme mit Recyclingtechnologien wie dem Parforce-Verfahren in Bottrop eine führende Rolle ein, müsse diese aber stärker politisch absichern, um „Versäumnisse wie bei Lithium oder Gallium“ nicht zu wiederholen.
Appell an Politik und Industrie
Für Bertau liegt die Lösung in mehr Eigeninitiative und Technologieoffenheit: „Wir müssen wieder Freude an der Zukunft finden!“ Deutschland solle moderne, effiziente Verfahren entwickeln statt den Status quo zu beklagen. „Schon ein Drittel Eigenproduktion würde reichen, um unabhängiger zu werden.“ Der Professor plädiert dafür, Elektromobilität ehrlich zu kommunizieren: „Gebt den Menschen die Autos mit Lithiumbatterien – aber ohne CO₂-Rucksack und ohne Umweltzerstörung in den Förderländern.“
Auch synthetische Kraftstoffe sieht er als Baustein eines breiteren Lösungsansatzes. E-Fuels seien „in Deutschland ein ideologisch verbranntes Thema“, obwohl man sie aus vorhandenem CO₂ und Biomasse längst großtechnisch herstellen könnte. Entscheidend sei, alle Technologien mitzudenken: „Menschen brauchen Mobilität, auch individuelle. Wenn wir ernsthaft etwas für das Klima tun wollen, brauchen wir ernsthafte Technologieoffenheit.“ (Anm. d. Red.: Hier findet man weitere Informationen zur Verfügbarkeit der E-Fuels in „ausreichender Menge“ – was derzeit nicht der Fall ist.)
Der Tenor seines Plädoyers: Europa hat die Rohstoffe, das Know-how und die Verantwortung, Lithium nachhaltiger und unabhängiger zu gewinnen – wenn es endlich wieder anpackt.
Quelle: Gateway to Automotive – Wo soll das Lithium herkommen?





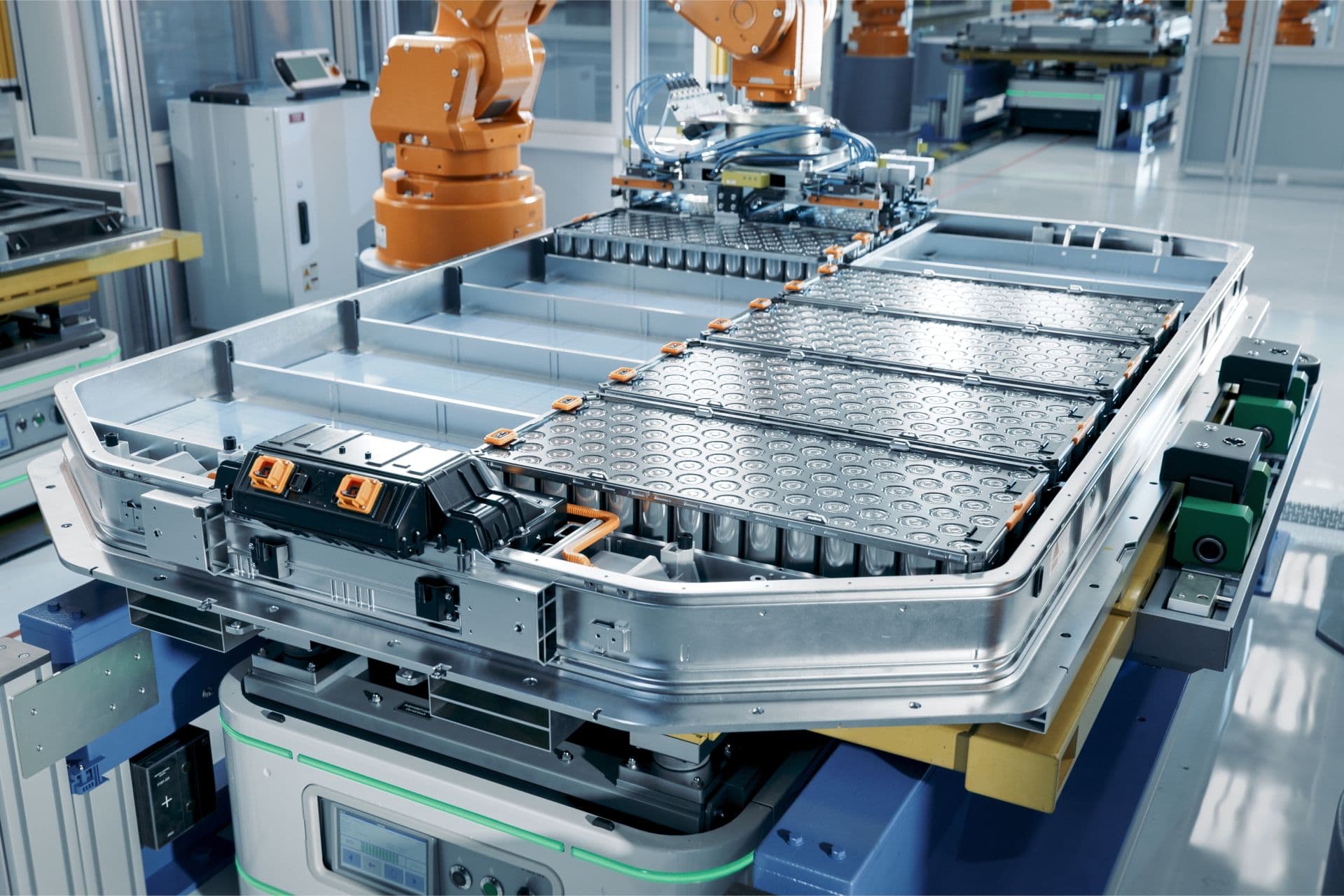



Wird geladen...