Während Tesla und viele asiatische Automobilhersteller schon länger vermehrt auf LFP-Akkus setzen, geben die meisten europäischen Hersteller weiterhin NMC-Batterien den Vorzug. Doch auch das ändert sich allmählich. Was die Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden chemischen Zusammensetzungen für Fahrbatterien sind, wollen wir heute einmal näher beleuchten. Das mit KI arbeitende Technologieprognoseunternehmen GetFocus ist sich jedoch schon sicher, dass LFP-Batterien die Zukunft gehören wird.
Zunächst einmal die wesentliche Gemeinsamkeit von LFP- und NMC-Akkus: In beiden spielt Lithium eine entscheidende Rolle. Bei LFP wird als Kathode Lithium-Eisenphosphat verwendet, bei NMC hingegen Nickel-Mangan-Kobalt-Oxide. NMC-Akkus haben eine höhere Energiedichte, können also auf weniger Raum und mit weniger Gewicht genauso viel Energie speichern wie eine in Sachen Kapazität gleich große LFP-Batterie.
Eine LFP-Batterie ist jedoch günstiger und gilt als sicherer, weil sie erst bei etwa 60 Grad höheren Temperaturen zu brennen beginnt – wobei die Brandgefahr von Elektroautos gemeinhin deutlich geringer ist als nachgesagt. Ein gutes Beispiel für die Energiedichte sind der Xpeng G6 als Standard Range sowie der G6 als Long Range: Erstgenannter hat eine 66-kWh-LFP-Batterie an Bord, diese wiegt genauso viel wie die 87,5-kWh-NMC-Batterie im Long Range.
Allerdings sind LFP-Batterien in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden, sodass der Unterschied bei der Energiedichte geringer wurde. GetFocus hat nun Patente und Patentanmeldungen weltweit von einer KI analysieren lassen und kommt zu dem Schluss, dass LFP sich auf lange Sicht wohl gegen NMC durchsetzen werde. In der Vergangenheit setzten dem Bericht nach Innovatoren wie BYD, SAIC, Geely sowie Entwickler – insbesondere Weltmarktführer CATL – auf LFP, lange bevor die europäischen Automobilhersteller dies bemerkten. “Tesla investierte von 2008 bis 2015 stark in Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien und verlagerte seinen Schwerpunkt in Forschung und Entwicklung ab 2016 schrittweise, was zu einer viel beachteten Umstellung auf LFP im Jahr 2021 führte”, erinnert GetFocus.
Europäer haben zehn Jahre Rückstand
Im Gegensatz dazu hätten die europäischen Automobilhersteller zwar bereits 2010 mit der Forschung und Entwicklung von Elektroautos begonnen. “Jedoch haben Marktgrößen wie Audi, BMW und Mercedes nur angedeutet, dass sie LFP-basierte E-Autos im Jahr 2025 auf den Markt bringen wollen”, schreibt das Unternehmen, das seine Methodik und deren Ergebnisse in den kommenden Tagen auch auf der Messe Hannover vorstellen möchte. Daraus ließe sich nicht nur eine anfängliche Verzögerung von fünf Jahren ablesen, sondern auch eine beinahe zehnjährige Verzögerung bei der Einführung fortschrittlicher Batterielösungen.

„Hätten die europäischen Automobilhersteller Zugang zu den von uns bereitgestellten Prognosen, würden sie nicht auf mehrere Technologien setzen“, findet Jard van Ingen, Geschäftsführer von GetFocus. „Unsere Daten zeigen, dass NMC-Akkus bei kalter Witterung besser abschneiden als LFP-Batterien, während LFP inzwischen in einem noch größeren Temperaturbereich eine vergleichbare Leistung bietet. Noch wichtiger ist jedoch die Herausforderung der Energiedichte, das Problem gilt es zu lösen. Anoden auf Siliziumbasis werden hierbei der Wendepunkt für LFP-Batterien sein und die nächste Welle der Batterieinnovation auslösen“, ist sich van Ingen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse sicher.
Quelle: GetFocus – Pressemitteilung im März 2025
Transparenzhinweis: Die PR-Agentur Connect and Drive von EAN-Herausgeber Sebastian Henßler unterstützt GetFocus bei seiner Pressearbeit. Auf die redaktionelle Bearbeitung der Pressemitteilung hat dies aber keinen Einfluss.



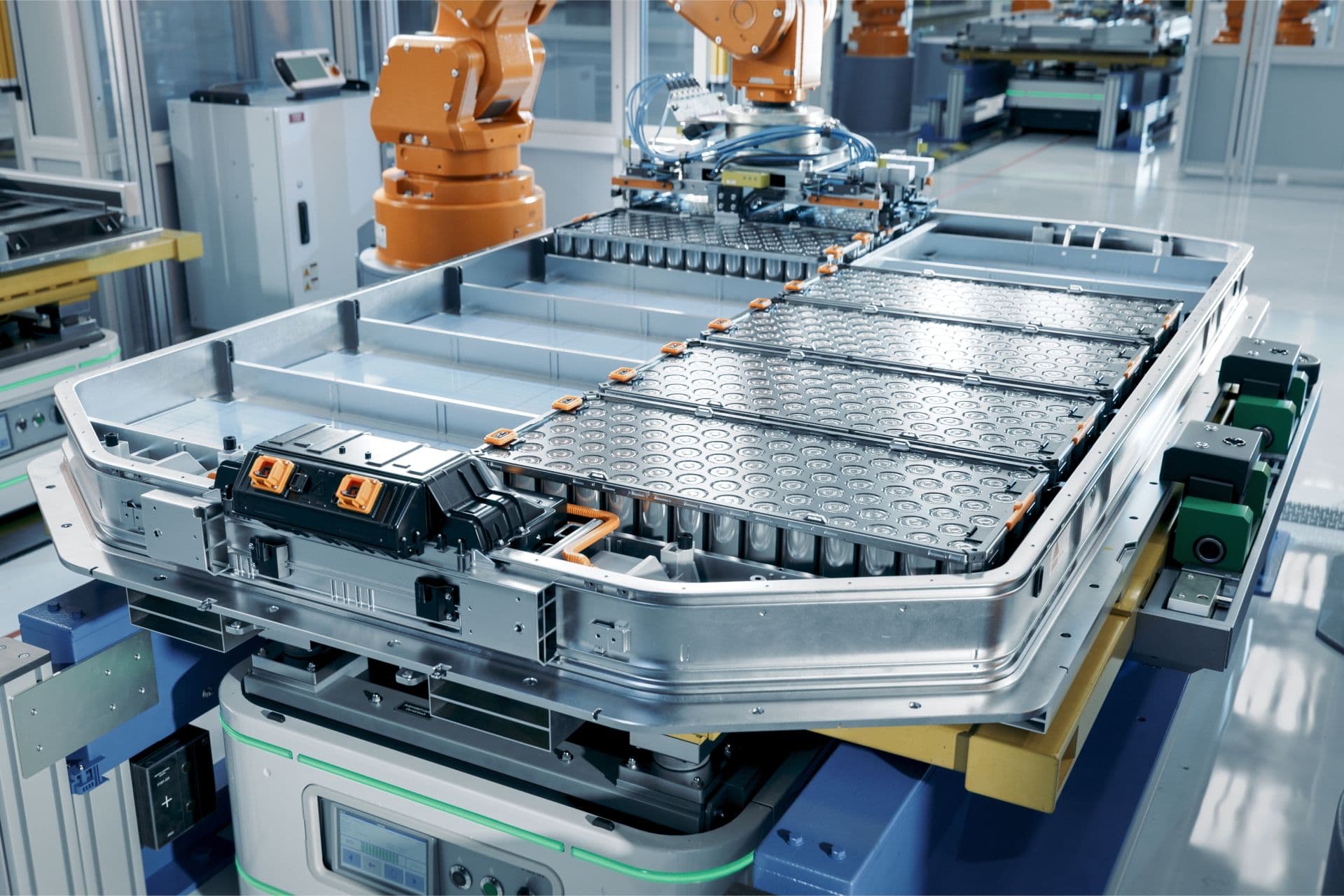





Wird geladen...